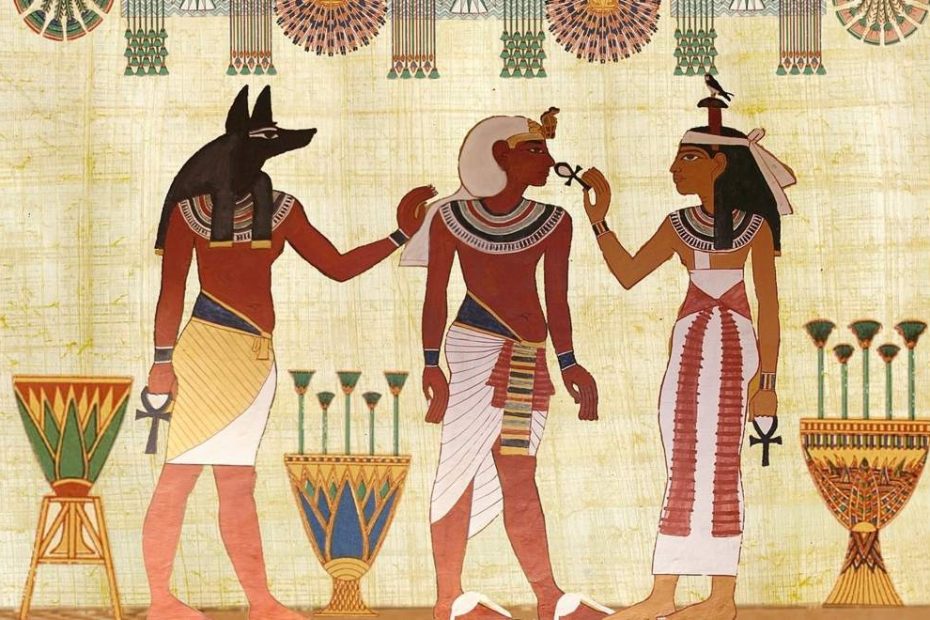Gegner der geschlechtergerechten Sprache verweisen gerne darauf, dass zwischen natürlichem und grammatischem Geschlecht keine Verbindung bestehe. Wer genau hinschaut, wird das Gegenteil bemerken: Genus und Sexus sind eng verwoben – ob wir nun von Tieren, Flüssen oder von Menschen reden.
Ein Beitrag von Prof. Dr. Gabriele Diewald und Prof. Dr. Damaris Nübling

Wenn man Flüsse personifiziert, geschieht das meist im Einklang mit ihrem grammatischen Geschlecht: Vater Rhein und Mutter Mosel am Kurfürstlichen Schloss in Koblenz.
In den letzten zwei Jahren hat sich der öffentliche Sprachgebrauch massiv verändert: An vielen Stellen wird gegendert. Entsprechend lebhaft ist die Diskussion. Zur geschlechtergerechten Sprache werden seit einem halben Jahrhundert Argumente gesammelt und Debatten geführt. Seit Jahrzehnten befasst sich die germanistische Linguistik wissenschaftlich mit diesem Thema. Trotz der Fülle an neuen Forschungsergebnissen werden diese im öffentlichen Diskurs kaum wahrgenommen. Stattdessen werden alte Auffassungen, die längst entkräftet sind, erneut vorgebracht, und gerne werden Forschenden in irreführender Weise und ohne Belege abwegige Positionen unterstellt, gegen die dann mit Scheinargumenten vorgegangen wird.
Im Folgenden greifen wir einen zentralen Topos auf, den die Kritik an der Bemühung um geschlechtergerechte Sprache notorisch wiederholt: die angebliche Verwechslung zwischen natürlichem (Sexus) und grammatischem Geschlecht (Genus). Sowohl Laien wie auch die Genderlinguistik seien – so diese Stimmen – nicht in der Lage, zu erkennen, dass das grammatische Genus im Deutschen – wie zum Beispiel das Maskulinum bei «der Hund» – ja nichts über das natürliche Geschlecht des mit diesem Ausdruck gemeinten Lebewesens aussage.
Kurz vorweg: Das Verhältnis von Genus und Sexus im Deutschen ist komplex. Genus und Sexus sind zu unterscheiden und stehen zugleich in enger Wechselbeziehung! Beide Aussagen sind gleichermassen gültig, beide muss man zur Kenntnis nehmen, wenn man sinnvoll über Sprache und Geschlecht reden will. Wir behandeln beide Aussagen der Reihe nach.
Prinzipiell unabhängig…
In der Tat haben Genus und Sexus insofern nichts miteinander zu tun, als sie prinzipiell voneinander unabhängig sind: Genus ist eine innersprachliche grammatische Kategorie, Sexus ein aussersprachliches, biologisches Phänomen. Dazwischen liegen weitere Phänomene, innersprachliche und aussersprachliche, so dass die Genderlinguistik nicht nur zwischen Genus und Sexus unterscheidet, sondern vier Ebenen annimmt. Dies sind: das natürliche Geschlecht (a); die gesellschaftlich geltenden Genderstereotype (b); das semantische Geschlecht (c); das grammatische Geschlecht (d).
Das natürliche Geschlecht (a) existiert prototypischerweise in der binären Unterscheidung zwischen «männlich» und «weiblich». Darüber hinaus existieren, wie man weiss, verschiedene andere Ausprägungen. Für Letztere gibt es im Deutschen bis anhin kaum lexikalische Ausdrucksmöglichkeiten, es liegt eine Benennungslücke vor.
Genderrollen (b) sind soziale Konzepte, typischerweise darüber, wie Frauen und Männer jeweils sind, denken, sich verhalten, sich kleiden usw. Genderrollen sitzen dem natürlichen Geschlecht auf und sind viel wichtiger als Geschlechtsorgane. Der biologische Unterschied zwischen Frauen und Männern wird mit zusätzlichen, willkürlichen Zuordnungen aufgebläht, wie etwa der Zuordnung von Farben oder von Kleidungsstücken zum einen oder anderen Geschlecht. Dass Genderrollen konstruiert – also nicht naturgegeben – sind, bedeutet nicht, dass sie keine gesellschaftliche Realität hätten. Im Gegenteil: Genderrollen haben auch in unserer modernen Gesellschaft eine stark normierende Kraft, Menschen, die sie nicht befolgen, etwa Röcke tragende Männer, gelten als lächerlich, jedenfalls nicht als «echte Männer».
Die beiden übrigen Ebenen sind rein innersprachliche Kategorien. Das semantische Geschlecht (c) gilt nur für Personen- und manche Tierbezeichnungen. Es ist fester Bestandteil der Wortbedeutung. So enthält das Wort «Tante» u. a. das semantische Merkmal «weiblich»; das Wort «Onkel» «männlich». Gleiches gilt für «Mutter» – «Vater», «Frau» – «Mann», «Schwester» – «Bruder», «Oma» – «Opa», «Kuh» – «Stier» usw.: Sie alle bringen die Opposition «weiblich» – «männlich» als Bestandteil der Wortbedeutung zum Ausdruck.
Wie man hier deutlich sieht: Das semantische Geschlecht ist in diesen Personenbezeichnungen nicht abhängig vom grammatischen. Wenn das Deutsche die Unterscheidung des grammatischen Genus bei den Artikelwörtern (der, die, das) aufgegeben hätte – wie es ja im Englischen der Fall ist –, so würde das der Wortbedeutung und ihren Unterscheidungsmerkmalen keinen Abbruch tun. Man vergleiche hierzu das Englische: «the aunt» – «the uncle», «the mother» – «the father». Das jeweilige Geschlechtsmerkmal ist Bestandteil der Wortbedeutung; das grammatische Genus ist nicht notwendig zum Ausdruck dieser Bedeutung.
Dies erkennt man auch an Beispielen wie «Mädchen» und «Weib», die eindeutig die Information «weiblich» enthalten, aber das grammatische Genus Neutrum aufweisen. Bei vielen Personenbezeichnungen wird dieser Unterschied durch Wortbildungsendungen (z. B. «-er» für «männlich» und «-in »für «weiblich») erzeugt: Männliches Suffix «-er»: «Hexe» – «Hexer». Weibliches Suffix «-in»: «Student» – «Studentin». Auch hier ist der Artikel nicht notwendig zur Realisierung des Merkmals «männlich» bzw. «weiblich». Viele Funktionsrollen werden so gebildet, dass an die männliche Endung «‑er» zusätzlich die weibliche «‑in» angehängt wird: «Fahrer» – «Fahrerin». Es gibt sehr viele semantische Paare dieser Art.
Die Kategorie Genus (d) ist im Deutschen bei allen Substantiven im Singular in einer ihrer drei Ausprägungen (Maskulinum, Femininum, Neutrum) vorhanden. Für sich genommen hat sie keinerlei geschlechtliche Bedeutung, was man an der Genusverteilung bei Gegenständen sehr gut erkennt («der Stuhl», «die Bank», «das Sofa» / «der Becher», «die Tasse», «das Glas»).
Aber – und nun wird es spannend – an manchen Stellen nimmt das Genus bei Personenbezeichnungen und sogar bei manchen Tierbezeichnungen sekundär geschlechtliche Bedeutung an. Hier sind wir also beim zweiten Punkt: Genus und Sexus stehen in enger Wechselbeziehung.
… aber doch zusammengehörig
Bei Personenbezeichnungen besteht eine äusserst enge Verbindung zwischen grammatischem Genus und dem Geschlecht einer Person. Das sieht man daran, dass fast alle semantisch weiblichen Bezeichnungen feminin und die männlichen maskulin sind: «die Tante», «die Mutter» – «der Onkel», «der Vater», ebenso «die Fahrerin» – «der Fahrer», «die Hexe» – «der Hexer». Diese Regel gilt zu fast 100 Prozent und belegt, dass Genus engstens auf Sexus verweist. Sogar wenn die Bezeichnung selbst kein semantisches Geschlecht enthält, leistet das Genus diese Zuweisung, wenn, wie es bei substantivierten Adjektiven und Partizipien der Fall ist, ursprünglich gar kein Genus vorhanden war. So etwa in «die» contra «der Angestellte», «die/der Alte», «die/der Vorsitzende». Hier zeigt einzig der Artikel als Träger von Genus das persönliche Geschlecht an.
Gegnerinnen und Gegner – dazu gehört auch der Verein Deutsche Sprache –, die eine solche Beziehung immer wieder in Abrede stellen, bringen typischerweise folgende Einwände vor:
Bei «das Weib», «das Mädchen» oder «die Schwuchtel» sieht man ja, dass Genus nichts mit Sexus zu tun haben kann. – Aus linguistischer Sicht stimmt das nicht, im Gegenteil: Betrachtet man diese vermeintlichen und sehr seltenen Ausnahmen genauer, dann bestätigen sie die obige Regel. Denn neutrale Frauen sind entweder solche, die ihre Genderrollen nicht erfüllen («das Weib» als Schimpfwort, «das Mensch» in Dialekten als liederliche Frau, «das Merkel» als versagende Politikerin), oder solche, die noch «unfertig» sind, d. h. entweder unreif oder unverheiratet («das Mädchen», «Fräulein»). Nur erwachsene, möglichst verheiratete, sozial arrivierte Frauen bekommen das «richtige» Genus («die Braut», «Frau», «Mutter»).
Ebenso werden homosexuelle Männer aus ihrer passenden Genusklasse ausgeschlossen, was ihre (historische) gesellschaftliche Verachtung spiegelt: Indem sie das gleiche Geschlecht begehren, wie dies Frauen typischerweise tun, werden sie grammatisch feminisiert («die Schwuchtel», «Tunte», «Tucke»). Gleiches gilt für männliche «Versager», deren Verhalten als zu wenig draufgängerisch betrachtet wird («die Memme», «Lusche»). Damit verweist das Genus nicht einfach nur auf das biologische Geschlecht (a), sondern vielmehr und subtiler auf soziale Genderrollen (b). Übrigens findet sich dieses Prinzip, sozial deviant bewerteten Menschen ein falsches Genus zuzuweisen, in vielen (Genus-)Sprachen der Welt, wie etwa die Sprachwissenschafterin Alexandra Aikhenvald in ihren Forschungen zeigt.
Der Löwe ist nicht trächtig
Der Verein Deutsche Sprache streitet jeglichen Genus-Sexus-Zusammenhang auch deshalb ab, weil «der Löwe» und «die Giraffe» keine Tiergeschlechter bezeichnen – er spricht hier sogar von einem «Generalirrtum». – Aus linguistischer Sicht ist auch das falsch: Abgesehen davon, dass die Linguistik eine solche Genus-Sexus-Verbindung bei Tieren nie behauptet hat, haben neueste Forschungen ergeben, dass auch hier – wenngleich abgeschwächt – Geschlechter assoziiert werden.
Erstens zeigt die Untersuchung von Tieren in Kinderbüchern, dass bei der Personifizierung von Raupen, Bienen, Käfern und Hunden deren Geschlechtszuweisung (die man an den Namen oder den Illustrationen erkennt) zu über 90 Prozent dem Genus ihres Substantivs folgt: «die Biene Maja», aber «der Käfer Manfred», «Frau Elster», aber «Herr Fuchs». Zweitens wurde unlängst in einer anderen Untersuchung gezeigt, dass rein grammatisch maskuline Tierbezeichnungen wie «der Löwe» (oder «der Hund», «der Elefant») nicht mit weiblichen Eigenschaften bzw. Aktivitäten kompatibel sind.
Solche Maskulina können also nicht in gleicher Weise z. B. «Junge bekommen» oder «säugen» wie Tiere, die im Femininum stehen, etwa «die Giraffe», «die Katze» oder «die Gazelle»: «Die Giraffe säugt ihr Junges» ist akzeptabler als «Der Elefant säugt sein Junges». Solche grammatisch maskulinen Tiere werden dann meistens in ein Femininum umgeformt: in «eine Elefantenkuh» oder «-dame», «eine Löwin», «Hündin». Eine Giraffe kann dagegen Junge säugen, hierzu bedarf es keiner «Giraffenkuh» oder «Giraffendame». Wäre jedoch, wie so oft behauptet, Genus von Sexus komplett unabhängig, müsste auch ein Hund oder ein Elefant trächtig sein oder Junge säugen können – genauso wie eine Katze oder eine Giraffe. Die Analyse riesiger Textkorpora zeigt aber: Das Genus bahnt die Vergeschlechtlichung auch bei Tieren.
Diese «Macht» bzw. dieses Sexuierungspotenzial von Genus erstreckt sich sogar jenseits von Mensch und Tier. Wenn unbelebte Objekte, Flüsse oder Gestirne personifiziert werden, dann ebenfalls in überproportionalem Ausmass Genus-Sexus-konform: «Die Sonne» wird stets als Frau, «der Mond» als Mann dargestellt (in der Romania umgekehrt, siehe das Spanische «el sol» – «la luna»), ebenso «die Mosel» («Mutter Mosel») bzw. «der Rhein» («Vater Rhein»). Und in einem Gedicht von Christian Morgenstern treten «Frau Gabel und Herr Löffel» auf.
Der immer wieder zu hörende Einwurf, Genus habe mit Geschlecht nichts zu tun, erweist sich als Bumerang: Bei genauerem Hinsehen haben die beiden viel mehr miteinander zu tun, als vielen klar sein dürfte. Am engsten ist diese Verbindung aber im menschlichen Bereich. Für die Frage nach geschlechtergerechter Sprache legt dies die Annahme nahe, dass maskuline Personenbezeichnungen wie «Arbeiter», «Passant», «Wissenschafter», «Leser» eine männliche Lesart auslösen. Auch diesen Zusammenhang hat die Linguistik längst empirisch belegt.
Genus und Sexus sind verschieden. Sie gehen aber an markanten Stellen in der deutschen Sprache enge Verbindungen ein. Die Genderlinguistik hat dies schon immer erkannt und betont. Beim Bemühen um geschlechtergerechte Sprache sind diese Verbindungen oftmals Problemstellen, die nicht leicht zu überwinden sind. Diese Tatsache ist kein Argument gegen geschlechtergerechte Sprache. Sie ist ein Argument für noch mehr qualifizierte Bemühung.
Gabriele Diewald ist Professorin für germanistische Linguistik am Deutschen Seminar der Leibniz-Universität Hannover, Damaris Nübling ist Professorin für historische Sprachwissenschaft des Deutschen an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
«Handbuch geschlechtergerechte Sprache» (Dudenverlag, 2020)
«Genderlinguistik. Eine Einführung in Sprache, Gespräch und Geschlecht» (Narr-Verlag, 2018)